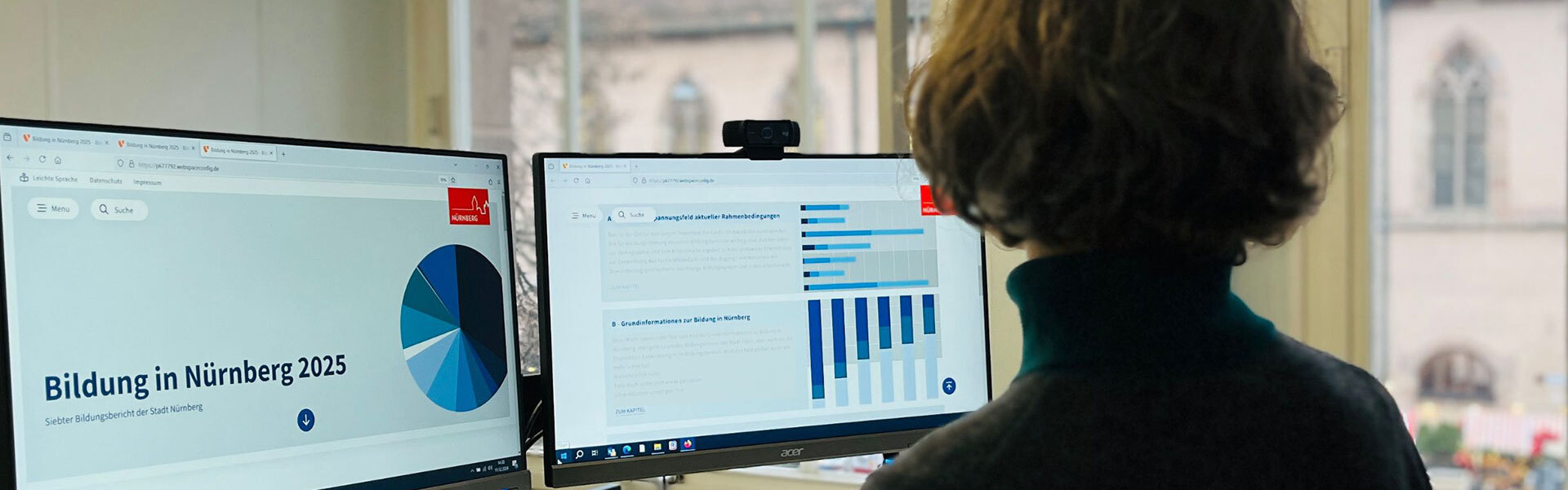Die politische Bildung stand im Mittelpunkt der diesjährigen Fürther Bildungskonferenz „Zwischen Mitbestimmung und Bullshit – Demokratiebildung im Krisenmodus“. Bei der Konferenz am 27.2.2025 in der Stadthalle Fürth wurden Impulse und Handreichungen gegeben, wie Demokratie besser vermittelt werden kann.
In seiner Eröffnungsrede verwies Markus Braun, Bürgermeister und Referent für Schule, Bildung und Sport in der Stadt Fürth darauf, dass die Demokratie vor großen Herausforderungen in der Zukunft steht. Er stellte die Frage in den Raum, wie eine neue Kultur der Demokratie aussähe, in der Fake News für wahr gehalten sowie Fiktion und Realität nicht mehr getrennt werden.
Zunächst erläuterte Dr. Florian Pfeil, Leiter der Fridtjof-Nansen-Akademie, Faktoren, die die Demokratie gefährden und was Kommunen dagegen tun können. So verzeichnete die Studie „Die distanzierte Mitte – Rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland“ der Universität Bielefeld nach der Corona-Pandemie einen Anstieg von demokratiegefährdenden Einstellungen wie Verschwörungsglaube, Populismus oder Billigung von politischer Gewalt. Antidemokratische Begriffe, die von den rechten Bewegungen in die politischen Diskurse gestreut werden, werden zunehmend gesellschaftsfähig, so Pfeil. Kommunen könnten dieser Entwicklung begegnen, indem sie den Fokus auf die politische Bildung der Bürgerinnen und Bürger richten. Ziel müsse es sein, demokratische Einstellungen und eine wertschätzende Zusammenarbeit zu stärken, Fake News durch objektive Berichtserstattung zu widerlegen und die Brandmauer zum Rechtsextremismus aufrechtzuerhalten. Hilfreich hierfür sei auch eine Vernetzung über die kommunalen Grenzen hinweg.
Anschließend verdeutlichte Heike Abt von der SINUS-Akademie anhand der Ergebnisse der SINUS-Jugendstudie 2024, dass sich Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren in verschiedenen Lebenswelten mit unterschiedlichen Werten bewegen. Wie die Studienergebnisse verdeutlichen, zeigt die Jugend trotz vieler gesellschaftlicher Krisen eine große Zufriedenheit im Alltag, sieht aber sorgenvoll auf die Themen Klima und Diskriminierung. Junge Menschen sehen zwar die Politik in der Verantwortung, Probleme zu lösen, halten sich jedoch bezüglich eigener politischer Aktivität zurück.
In der nachfolgenden Gesprächsrunde kamen die drei Vortragenden überein, dass einerseits Medien- und Demokratiebildung schon in der Grundschule beginnen müsse und andererseits politische Bildung als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu betrachten sei. Politische Bildungsangebote sollten projektbezogen erfolgen, damit die Menschen bei ihren Themen abgeholt werden können.
Anschließend wurden verschiedene Fachforen angeboten, in denen Fachkräfte aus den unterschiedlichen Bildungsbereichen Anregungen und Empfehlungen zu einer besseren Demokratiebildung und zur Stärkung des demokratischen Handelns in der Praxis erhielten und diskutierten.